Droht eine neue Schuldenkrise in der Eurozone? (Dr. Wolfgang Merz)
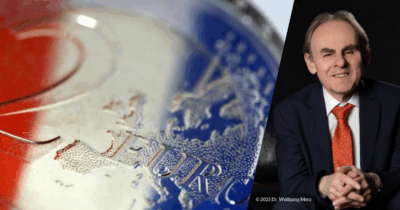
Frankreichs Haushaltslage verschärft sich: Mit über 114 % Staatsverschuldung, schwachem Wachstum und politischer Zersplitterung steht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone unter besonderer Beobachtung. Ratingagenturen reagieren mit negativen Ausblicken, die Zinsen steigen, das Vertrauen der Märkte sinkt. Dr. Wolfgang Merz analysiert die zentralen Risiken – und die Unterschiede zur Eurokrise vor zehn Jahren.
Droht eine neue Schuldenkrise in der Eurozone?
Von Dr. Wolfgang Merz, 31.10.2025
Hintergrund
Spekulationen über eine neue Schuldenkrise in der Eurozone werden vor allem dadurch genährt, dass das hochverschuldete Frankreich bei sehr hohen laufenden öffentlichen Defiziten seine politische Stabilität weitgehend verloren hat. Hinzu kommt, dass auch Italien seine exzessiv hohen Schulden nicht abbauen kann und Deutschland sich entschieden hat, dieses Instrument deutlich stärker als in der Vergangenheit einzusetzen.
Eine globale Entspannung ist nicht in Sicht: Trump wird die Staatsverschuldung der USA erneut massiv erhöhen, viele Länder in Afrika sind auch mit chinesischen Krediten konfrontiert, und Russland ist für die Kriegsfinanzierung zunehmend auf öffentliche Kredite angewiesen.
Frankreich als möglicher auslösender Faktor
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone hat in den letzten Jahrzehnten versäumt, trotz zum Teil hoher Wachstumsraten ihre öffentliche Verschuldung mit den finanzpolitischen Stabilitätskriterien in Einklang zu bringen. Die Folge ist ein immer weiter anschwellender Staatsapparat mit hohen Ausgaben für Soziales, Subventionen und Verteidigung und eine stetig steigende Staatsquote. Für 2025 wird diese auf über 56 % des Bruttoinlandsprodukts geschätzt.
Zudem gilt das System der französischen öffentlichen Finanzen als intransparent. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU war nicht in der Lage, dieser Entwicklung Grenzen zu setzen. Während die Schuldenquoten von Frankreich und Deutschland früher ungefähr gleich hoch waren, hat sich Frankreich längst abgekoppelt und mit rund 114 % des Bruttoinlandsprodukts die Marke von 100 % deutlich überschritten.
Angesichts dieser angespannten Haushaltslage hat Frankreich wiederholt versucht, nationale Dossiers auf die EU-Ebene zu verlagern, um über europäische Finanzierungen Entlastung zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund haben namhafte Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des französischen Staates bereits herabgestuft oder drohen mit einem solchen Schritt und vergeben negative Ausblicke. Solche Herabstufungen schwächen das Marktvertrauen, erhöhen die Risikoprämien und damit die Zinsen für französische Staatsanleihen. Die ohnehin hohe Zinslast des Staates steigt weiter.
Begründet wird dies mit einer zunehmenden politischen Zersplitterung des Landes und den daraus folgenden Risiken für eine stabile Finanzpolitik. Hinzu kommt, dass verschleppte Reformen das Wachstumspotenzial der Wirtschaft dämpfen. Besonders gravierend ist die vorläufige Aufgabe der Rentenreform, des Prestigeprojekts des französischen Präsidenten.
Frankreich erlebt die schwerste politische Instabilität seit Gründung der Fünften Republik 1958. Schwaches Wachstum, hohe Arbeitslosigkeit und verbreitete soziale Unzufriedenheit verschärfen die Lage. Präsident Macron verfügt über keine klare Parlamentsmehrheit und sieht sich einer wachsenden politischen Fragmentierung gegenüber.
Faktoren, die die Lage in der Eurozone vorerst stabilisieren
Nach der Eurokrise wurden Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, die die Widerstandskraft der Eurozone erhöht haben. Der Bankensektor ist heute stabiler; auch das französische Bankensystem verfügt bislang über ausreichend Eigenkapital und Liquidität.
Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) existiert eine Institution, die in Krisenfällen aktiv werden kann. Die Europäische Zentralbank hat zudem mit dem „Transmission Protection Instrument“ ein weiteres Instrument geschaffen, das im Notfall zum Einsatz kommen kann. Den Finanzmärkten sind diese Sicherungsmechanismen bewusst.
Ein Ansteckungsrisiko für die Eurozone entsteht vor allem dann, wenn mehrere Länder gleichzeitig ein höheres Zinsniveau schultern müssen. Solange im Wesentlichen Frankreich höhere Renditen verarbeiten muss, bleibt das Risiko begrenzt.
Dennoch gilt: Die französische Politik muss es zumindest im Ansatz schaffen, eine haushaltspolitische Linie einzuschlagen, die eine Trendumkehr bei der steigenden Schuldenquote ermöglicht. Gelingt dies nicht, reagieren Finanzmärkte und Ratingagenturen, und der skizzierte Teufelskreis setzt sich fort. Ab einem bestimmten Punkt stellt sich dann trotz größerer Resilienz die Frage nach der Stabilität der Eurozone.
Ein Vergleich mit der damaligen Rettung Griechenlands greift jedoch zu kurz. Die ökonomische Größe Frankreichs macht eine solche Situation qualitativ und quantitativ zu einem anderen Szenario.
Fazit: Eine europäische Schuldenkrise ist nicht akut, erfordert aber hohe Wachsamkeit
Eine durch Frankreich ausgelöste Schuldenkrise droht derzeit nicht. Die Eurozone ist robuster geworden, und die letzte Eurokrise hat gezeigt, dass man Aktionen der Ratingagenturen nicht überbewerten sollte. Sie agieren häufig prozyklisch und mit eigenen strategischen Motiven.
Dennoch ist es unabdingbar, dass Frankreich seine finanzpolitischen Probleme zumindest teilweise in den Griff bekommt. Zugleich muss Europa in den kommenden Jahren einen stabilen Wachstumspfad erreichen. Die Umsetzung wesentlicher Elemente des Draghi-Berichts zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU wäre dafür eine gute Grundlage.
Das Beispiel Frankreich ist auch eine Mahnung an Deutschland. Sollte es nicht gelingen, kreditfinanzierte Ausgaben in Höhe von rund einer Billion Euro wachstumsfördernd einzusetzen, könnte sich Deutschland in einigen Jahren in eine ähnliche Lage manövrieren.
Neben einer möglichen Schuldenkrise darf ein weiterer Punkt nicht übersehen werden: Die Finanzmärkte haben ihren Gleichgewichtspfad offenbar verlassen. Boomende Aktienmärkte, getrieben auch von großer Euphorie über die Chancen der Künstlichen Intelligenz, sowie stark steigende Gold- und Silberpreise deuten auf eine Überhitzung hin.
Kommt es zu deutlichen Korrekturen nach unten – etwa, weil Zweifel an den Ertragspotenzialen der Künstlichen Intelligenz aufkommen – droht eine erneute Finanzkrise. In Verbindung mit einer hohen Verschuldung wichtiger Volkswirtschaften entstünde eine Mixtur, die die Finanzwelt in Turbulenzen stürzen und sehr negative Folgen für die reale wirtschaftliche Aktivität haben könnte.
//
Der Autor Dr. Wolfgang Merz ist Berater, Dozent und Autor mit umfassender Erfahrung in nationalen, europäischen und internationalen Prozessen. Als ehemaliger leitender Mitarbeiter im Bundesministerium der Finanzen und Economist beim Internationalen Währungsfonds bietet er strategische Beratung, praxisnahe Bildung und fundierte Publikationen an. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Ökonomie und Politik, um Organisationen und Individuen in einer vernetzten Welt zu unterstützen. Mehr unter: www.wolfgang-merz.de
//
Die Rubrik EAB Impulse bietet Meinungen und Analysen zu aktuellen Entwicklungen in Europa. Die Beiträge spiegeln allein die Perspektiven der Autorinnen und Autoren wider und laden zum Nachdenken und Diskutieren ein. Weitere Informationen zur Arbeit der Europäischen Akademie Berlin und zu ihren Angeboten finden Sie unter:
Homepage: www.eab-berlin.eu | Newsletter: www.eab-berlin.eu/newsletter
